|
|
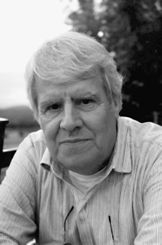 |
||
|
Stefan Meuschel |
||
„Au Backe!“, konnten die Leser nur stöhnen, wenn da in den Rezensionen mit „Ab in die Mottenkiste“ (Süddeutsche), mit „Schmachtfetzen“ (Tagesspiegel) oder mit „Deutschland, verflache!“ (Welt) auf das „plärrige Libretto“, den „klingenden Kitsch“ und das „biederste Erzähltheater“ eingedroschen wurde. Die Leser mochten zwar stutzig werden, weil in jeder Besprechung der so genannte „Idomeneo-Skandal“ (vgl. Editorial in „Oper&Tanz“, Ausg. 5/06) oder die Probleme der Opernstiftung erwähnt wurden, weil musikhistorische Bezugnahmen, zum Beispiel zu Mahler, chronologisch daneben lagen oder weil sich ihnen die Frage aufdrängte, warum denn Toscanini fast dreißig Jahre die „Germania“ im Repertoire behielt, wenn deren Musik doch „erschreckend simpel getaktet und ohne Eigenwert“ ist. Verstand Toscanini von der Musik seiner Zeit so wenig?
Noch auffälliger waren Anwürfe der Art, die Ausstattung sei „den historischen Vorbildern abgeschaut“. Preußens Königin Luise ist nicht in Blue Jeans oder gar als Nackedei aufgetreten, erfuhren die Leser, und die aufständischen Intellektuellen und Studenten der Jahre 1806 bis 1813 hantierten nicht mit Kalaschnikows und Dynamitgürteln. Ist das denn im Regietheater erlaubt?
Entgegen der Absicht der Verrisse, die Besucher von solch einer garstigen Aufführung der Deutschen Oper Berlin fernzuhalten, hilft bei den aufkommenden Zweifeln doch nur eines: Hingehen und sich selbst einen Eindruck verschaffen. Und der ist: Ein interessanter, überwiegend großer Abend. Eine in der Exposition etwas mühsame, in ihrer ausgestellten Komik zunächst gewöhnungsbedürftige, dann spannend werdende, stark idealisierende Schilderung deutscher historischer Ereignisse aus italienischem Blickwinkel, zusammengehalten von der zeittypischen Dreiecksgeschichte des Vor-Kino-Melodrams. Das Libretto ist eher weniger krude als das, was „Germania“-Autor Luigi Illica sonst für Puccini (zusammen mit Giacosa) und für Giordano geschrieben oder was Piave Verdi zugemutet hat. Und die Partitur ist meisterlich.
Die Suche nach einer Erklärung für die auffallend einhellige Ablehnung der Aufführung durch die Tagespresse führt zu drei Vermutungen. Hier sollte in der wieder hochgekommenen, hitzigen Debatte um die „Stiftung Oper in Berlin“ die Theaterpolitik mit anderen Mitteln fortgesetzt werden. Hier sollte klar gemacht werden, dass eine handwerklich tadellose, Mätzchen und Provokationen aussparende veristische Inszenierung nicht in die Zeit der Events passt. Hier verstörte – und das gilt wohl auch für die Reaktionen des Publikums auf einige Szenen – die Darstellung eines Ausschnitts deutscher Geschichte, deren – aus heutiger Sicht – naiver Patriotismus, italienisch temperiert, und deren ebenso naive Vorstellungen von einer friedlichen, von Philosophen, Dichtern und Musikern geprägten Bürgergesellschaft so gar nicht ins Geschichtsbild passen, das unsere Standpunktsprothesenträger als einen geradlinigen Weg von Luther zu Hitler darstellen. Das Nachdenken auslösende Erschrecken über „Lützows wilde verwegene Jagd“ und über die Ausstellung authentischen Opferwahns ist aber deren Vernebeln oder Denunzieren vorzuziehen.
Animierte die Kritik zur Auseinandersetzung mit Werk und Inszenierung, wäre sie förderlich und hoch willkommen. Die ungerechtfertigte, uniforme Vernichtung von Werk und Inszenierung jedoch ist geeignet, auch theaterpolitische Schieflagen herbeizuführen, von denen die „Stiftung Oper in Berlin“ (vgl. Brennpunkte auf S. 6) schon zur Genüge hat.
Ihr Stefan Meuschel
|
|
|
© by Oper &
Tanz 2000 ff. |

