|
|
|
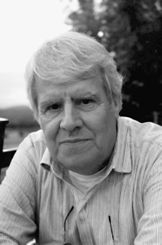 |
||
| Stefan Meuschel |
||
Keines Propheten bedarf es für die Vorhersage, dass auf Jahre hinaus die öffentlichen Hände leer bleiben und sich nur zu hilflosen Gesten verstehen werden. Die Folgen politischer Fehlleistungen und wirtschaftlicher Einbrüche, über Jahre mit teilweise abenteuerlichen Kreditaufnahmen kaschiert, schlagen in einer Vielzahl von Fällen erst jetzt auf die Haushalte voll durch. Manche Kommune weiß nicht mehr, mit welchen Sanierungskonzepten sie der drohenden Zwangsverwaltung entgehen soll.
Da aber einerseits die deutschen Theater, Opern und Orchester sich nicht „zur Disposition der Geldgeber“ stellen lassen wollen, andererseits die bisher zum Erhalt der Kultureinrichtungen eingesetzten Instrumentarien wie Angebotssteigerung, Personalabbau, Fusionen und vor allem der Gehaltsverzicht der Beschäftigten durch haustarifvertragliche Regelungen zum allmählichen Umschlag in den Verlust der Qualität und damit der Existenzberechtigung führen werden, stellt sich die historische Frage: Was tun?
Zwar ist es richtig, wenn im Raue-Gutachten gesagt wird, dass derjenige sich lächerlich mache, der die existentiellen Probleme der deutschen Kultureinrichtungen allein mit dem Ruf nach mehr Geld beantworte, ebenso richtig ist es aber auch, dass in einem Land, das parteienunisono „Bildung als wichtigste Volksressource“ deklariert, die Feststellung erlaubt sein muss, dass alle vergleichbaren Staaten mehr in die Bildung investieren als die Bundesrepublik. 5,3 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts sind es gerade mal; in den USA sind es 7,2 Prozent, in Schweden 6,9 Prozent, in Frankreich 6,1 Prozent. Ästhetische Bildung durch Vermittlung von Kunst ist unverzichtbarer Bestandteil jeglicher Kulturpolitik.
Doch der „Ruf nach mehr Geld“ allein wäre in der Tat lächerlich. Das Raue-Gutachten ebenso wie ein entsprechendes Gutachten des Deutschen Bühnenvereins enthalten eine Reihe sinnvoller Anregungen für den Gesetzgeber, sich kunstfreundlicher zu verhalten, beginnend bei der Entbürokratisierung, noch lange nicht endend beim Steuerrecht. Zu wünschen ist daher, dass die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ in der neuen Legislaturperiode des Deutschen Bundestages ihre Arbeit abschließen kann, um konkrete, auch von den Betroffenen nachprüfbare Handlungsempfehlungen statt nur mehr oder minder kluge Analysen zu hinterlassen.
Sehr viel könnten die Theater, Opern und Orchester kostenmindernd auch selbst tun. Wenn die kooperierenden Kultureigenbetriebe einer Stadt so viele künstlerische Betriebsbüros unterhalten, die obendrein mit nicht kompatiblen Rechnerprogrammen ausgestattet sind, dass im Ergebnis das Ballett oder das Orchester exakt dann irgendwo gastiert, wenn es im Opernhaus benötigt wird, so dass teure Aushilfen engagiert werden müssen, beweist das ein Fehlen jeglichen Organisations-Controllings. Ein Beispiel nur für unzählige andere.
An der hehren Kunstfreiheits-Gloriole der Theaterleitungen, vielleicht auch an ihren historischen Wurzeln im Feudalismus mag es liegen, dass innerbetriebliche Kommunikation im Theater oft als unziemliche Mitbestimmungsforderung angesehen wird. Als der Präsident der US-amerikanischen Piloten-Gewerkschaft „Allied Pilots Association“, Ralph Hunter, unlängst gefragt wurde, warum von den fünf großen US-Airlines nur „American“ und „Continental“ nicht insolvent seien, antwortete er, dies läge am dort „deutlich kooperativeren Verhältnis von Belegschaft und Management“.
Ein Lichtblick in finsteren Zeiten: Andreas Homoki, Intendant der Komischen Oper Berlin, hat einen monatlichen Stammtisch für sein Ensemble eingerichtet.
Ihr Stefan Meuschel
|
|
|
© by Oper &
Tanz 2000 ff. |

