|
|
|
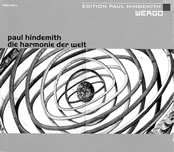 |
||
Verlagseigene Interessen verfolgt hierbei das zum Schott-Verlag gehörende Label Wergo, das in seiner Hindemith-Edition nun die Kepler-Oper „Die Harmonie der Welt“ veröffentlichte. Hindemiths Großwerk, das als eine Zusammenfassung seiner philosophischen wie musikästhetischen Theorien zu werten ist, wurde schon ab 1939 ins Auge gefasst. Die gesellschaftlichen und politischen Katastrophen der folgenden Jahre verzögerten die Ausarbeitung. Im Sinne hatte Hindemith ein Stück, das sich „um die Suche nach Harmonie in allen Welt- und Lebensdingen und um die Einsamkeit desjenigen, der sie findet“ drehen sollte. Erst 1957 konnte die Oper abgeschlossen werden, die noch im gleichen Jahr im Münchner Prinzregententheater uraufgeführt wurde.
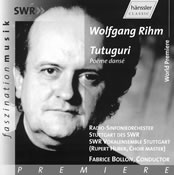 |
||
Einsamkeit – dieses Schicksal widerfuhr im Grunde auch der Oper. Sie stand
quer zu einer fortschrittsgläubigen Zeit. Rückwärtsgewandtheit
wurde sowohl musiktechnisch als auch im philosophischen Ansatz wahrgenommen.
Umso erfreulicher ist es, dass nun eine rundum engagierte, ernsthafte und zugleich
tief musikantische Einspielung vorliegt. Marek Janowski gelingt es, den großen
Spreizschritt der Komposition zwischen der (auch musikalisch zu verwirklichen
gesuchten) vollkommenen Harmonie des Alls und den Verstrickungen des Individuums
in aufgewühlte Zeitumstände sinnfällig zu machen (das Stück
spielt zwischen 1608 und Keplers Todesjahr 1630).
Ein Ballettwerk von Wolfgang Rihm, Jahrgang 1952, ist nun beim Label Hänssler
aufgelegt. „Tutuguri – Der Ritus der schwarzen Sonne“ nach
Antonin Artaud entstand aus der wohl rücksichtslosest agressiven Periode
Rihms – und innerhalb dieser darf „Tutuguri“ (geschrieben zwischen
1980 und 1982) wohl das entschiedenste Ausleben von nacktem, rohen Klang für
sich beanspruchen. Es wirkt so, als wolle der Komponist alle ästhetischen
Vorgaben von Differenzierung und subtiler Struktur mit Gewalt niedertreten und
damit seiner Abscheu gegenüber artifizieller Künstlichkeit ein für
alle Mal eine Absage erteilen. „Tutuguri“ ist Rihms „Sacre“,
ein Ritual der penetrierenden Rhythmen, der scharfen Bläserlinien, des wilden
Schlagwerkgewitters. Und wie immer ist es bei Rihm so: wenn etwas in schreiender
Auflehnung und ohne Filter direkt aus seinem Körper kommt, dann weiß er
Wirkungen von ungeheuerer Durschlagskraft zu erzeugen. Von dieser Unmittelbarkeit,
Explosionslust und Fleisch-Blut-Manie hat das Stück bis heute nichts eingebüßt.
Die Einspielung unter Fabrice Bollon ergreift gierig diese rituellen Zeichen
und setzt sie überlegen um.
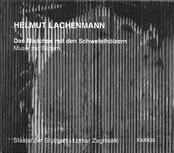 |
||
Mit der Musik in Bildern „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ von Helmut Lachenmann ist nun auch beim für das Zeitgenössische so verdienstvollen Label Kairos das vielleicht wichtigste Musiktheaterwerk der 90er-Jahre aufgelegt worden. Bei der Hamburger Uraufführung, die (wie hier auf der CD) von Lothar Zagrosek geleitet wurde, empfanden viele spontan, dass sie Musik gehört hatten, die beim Wiederhören eine Fülle an geahnten, aber durchaus nicht voll erfassten Reichtümern offenbaren würde. Andersens tieftrauriges Märchen von einem frierenden Mädchen, das Streichhölzer verkaufen möchte und wegen des Misserfolgs sich die Wärme und die sich einstellenden Visionen einiger entzündeter Hölzer gewährt, zeichnet das Bild eines desolaten Daseins. Jedes angeriebene Holz schmälert den Tauschwert-Besitz des Mädchens und treibt es in weitere Enge und Kälte bis zum Tod. In Gudrun Ensslin, Mitglied der RAF, sah Lachenmann parallele Bilder. Wir verurteilen das Tun (auch das des Streichholz-Mädchens, das „Besitz verschleudert“) ohne sehen zu wollen, dass wir selbst die Auslöser sind. Wie soll das zu Musik werden? Es macht häufig „Ritsch“ in dieser Oper, hat Lachenmann selbst einmal erläutert. Wirklich entzündet (das Wort ist dem Werk eingeschrieben) sich die ungeheuere Klangphantasie immer wieder am Anreißen des Klangs auf rauher Fläche. Und er gebiert, das ist das Niederschmetternde, daraus immer größere Kälte und Frost. Die Musik, angefüllt von Ausblicken, Lebenssehnsucht, Hoffnung, verbraucht sich selbst und erleidet den Kältetod. Wer aber kalt ist, den friert nicht mehr (so heißt es schon im Wozzeck), und so beschließt ein großes Sho-Solo (chinesische beziehungsweise japanische Mundorgel) wie eine ins Unendliche fortgeschriebene Utopie von entrücktem Glück die Oper. Der Klang wird eins mit den Bildern; dies in einer Nachdrücklichkeit, wie sie nur wenigen musiktheatralen Werken gegeben ist.
Info
Paul Hindemith: Die Harmonie der Welt. Arutjan Kotchinan, François le Roux, Robert Wörle, Christian Eisner u.a., Gesang: Rundfunkchor Berlin, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Marek Janowski. Wergo 6652 2 (3 CDs).
Wolfgang Rihm: Tutuguri (Poème dansé). Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, SWR Vokalensemble Stuttgart, Fabrice Bollon. Hänssler CD 93.069 (2 CDs).
Helmut Lachenmann: Das Mädchen mit den Schwefelhölzern (Musik mit Bildern). Elizabeth Keusch, Sarah Leonard, Sopran; Salome Kammer, Sprecherin; Mayumi Miyata, Sho; Staatsopernchor und Staatsorchester Stuttgart, Lothar Zagrosek. Kairos 0012282KAI (2 CDs).
|
|
|
© by Oper &
Tanz 2000 ff. |

