|
|
|
 |
||
|
Die Moderatorin: Bettina Volksdorf. Foto: Archiv |
||
Bettina Volksdorf: Zum Kulturauftrag der Theater gehört ja auch, dass sich gerade große Theater dem zeitgenössischen Musiktheater widmen, und ich denke, gerade die großen Häuser haben da eine besondere Verpflichtung. Wenn ich an ein Ausnahmestück denke wie Lachenmanns „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“: Dieses Stück bedeutete für die meisten Chorsänger absolutes Neuland, das war künstlerisch eine Grenzerfahrung, weil es eben nicht mehr nur um den Umgang mit der Stimme, sondern mit dem gesamten Körper ging. Brauchen Opernchöre möglicherweise auch diese Ausnahmeprojekte, um dann entsprechend in der Öffentlichkeit dafür honoriert zu werden?
Frieder Reininghaus: Mit Sicherheit bringen solche Stücke das Theater insgesamt weiter und gewiss auch die Chorsänger; zumal, wenn sie dort als Solisten agieren. Überhaupt kennt das Theater keinen Stillstand – Regressionsphasen kennt es durchaus. Seit es am Ende der Renaissance entstanden ist, entwickelte gerade auch das Musiktheater sich ständig weiter, kreierte immer wieder neue Gattungen, Genres, Stilrichtungen und Produktformen. Der Chor profitiert in der Regel, wenn er von den Innovationsprozessen nicht ausgeschlossen wird. Als größtes Problem erscheint mir hinsichtlich des unaufhaltsamen Fortschritts jedoch, dass von den wenigstens 100 Kompositionsaufträgen, die hier zu Lande jedes Jahr vergeben werden, nur drei oder vier noch mit großer Chorbesetzung bedacht werden. Der überwiegende Teil der Auftrags-Produktionen führt zu Kammeropern; diese lassen sich gerade auch in kleinen Häusern mit wenig Aufwand relativ rasch produzieren – eine Sparmaßnahme. Ein Nebeneffekt besteht meist darin, dass die Häuser durch die Uraufführung in die Presse kommen, vielleicht sogar in die überregionale, dass die einzelnen Produktionen jedoch vergleichsweise viel weniger kosten als eine gut ausgestattete Mozart-Produktion oder irgendein mittlerer Verdi. Leicht kann der Chor zu den Modernisierungsverlierern am Theater gehören. Dagegen müssen die Chorvorstände und die Chorgewerkschaft gegebenenfalls angehen und von den Intendanten fordern beziehungsweise bei Mäzenen anregen, dass bei der Auftragsvergabe auf die Mitwirkung des Chores geachtet wird.
Volksdorf: Um noch mal auf das „Mädchen mit den Schwefelhölzern“ zurückzukommen: Die Einstudierung von Lachenmanns Musiktheater an der Staatsoper Stuttgart war auch so etwas wie Knochenarbeit. Das war nicht nur ein Jahr richtig straffe Arbeit gerade auch mit dem Chor, sondern es kostete wohl bei einigen Kollegen aus dem Chor einige Überzeugungsarbeit. Letzten Endes wurde das Produkt so abgeliefert, dass es überregional für Aufmerksamkeit gesorgt hat, aber es braucht, glaube ich, doch Mut, Neugierde und Begeisterungsfähigkeit gerade im Chor, um so etwas realisieren zu können. Herr Meuschel, der Zeitfaktor für die Einstudierung eines solchen zeitgenössischen Werkes ist ja nicht zu unterschätzen. Wie stünden Sie eigentlich dazu oder wie stünde die VdO als Berufsverband dazu, wenn man jetzt mal laut darüber nachdenken würde, die Probenzeiten gelegentlich etwas flexibler zu gestalten?
Stefan Meuschel: Dagegen ist nichts einzuwenden und es gibt keinen zeitgemäßeren Tarifvertrag als den, den die Opernchöre haben. In Übereinstimmung mit dem Opernchor-Vorstand kann jede Arbeitszeit beliebig verlängert werden. Wir sind so flexibel, wie die Arbeitgeberverbände nur träumen können.
Volksdorf: Herr Brauer, entspricht das Ihren Erfahrungen als Chordirektor?
 |
||
|
Matthias Brauer Foto: Matthias Creutziger |
||
Matthias Brauer: Ich kann ja nur
von meiner ureigensten Erfahrung sprechen, die ich mit meinem Chor
in Dresden mache. Wir
sind schon
sehr flexibel in den Probenarbeiten, denke ich, und das ist ein
Geben und Nehmen. Aber so flexibel sehe ich das Tarifrecht, wenn
ich es schwarz auf weiß lese, überhaupt nicht. Es wäre
wunderschön, wenn es denn so wäre, aber kein Chorvorstand,
mag er noch so willig sein, wird sich gegen seine eigenen Chorkollegen
stellen. Im Zweifel findet diese Probe nur in den tarifrechtlich
vorgegebenen Zeiten statt. Ich persönlich habe diese Erfahrung
nicht gemacht und gerade in schwierigen Situationen haben wir sehr
flexible Lösungen in Dresden. Aber vom Tarifrecht her sehe
ich es so einfach nicht.
Ich möchte nur ganz kurz zu Lachenmann etwas sagen. Ich bin
kein Gegner der modernen Musik. Aber ich glaube, die Erfahrungen,
die man dabei macht, sind letztendlich immer Grenzerfahrungen.
Allein die technischen Möglichkeiten für ein solches
Stück sind für meine Begriffe begrenzt und in zu großer
Häufung leidet die Qualität der normalen Klangkultur
eines Chores darunter.
Volksdorf: Wir haben einen Vertreter des Stuttgarter Opernchor-Ensembles im Publikum. Herr Czerny, ist das so, wie Herr Brauer das formuliert hat? Wäre das auf Dauer eine Stimmschädigung?
Henrik Czerny: Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Wenn man das auf Dauer macht, dann können Sie die klassische Oper praktisch vergessen. Die Anforderungen, die wir dort hatten, waren ja praktisch fern jeden Gesangs. Wir haben Geräusche produziert, wir hatten mit Dingen zu tun, mit denen man sonst nie zu tun hat, wir haben mit Styropor gearbeitet, mit Panflöten, die völlig verfremdet wurden und Ähnliches. Aber vor allem die stimmliche Belastung ist enorm, weil es wirklich mit Gesang nichts mehr zu tun hat. Und wenn Sie das mehrfach im Jahr machen – abgesehen davon, dass natürlich der Zeitaufwand immens ist und andere Teile in der Oper oder im Opernchor, die probiert werden müssen, darunter leiden – dann verlieren Sie schlichtweg irgendwann den Kontakt zum ganz normalen Gesang.
 |
||
|
Der Journalist Frieder Reininghaus (Foto: Archiv). |
||
Reininghaus: Ich musste nicht mitsingen, könnte mir aber vorstellen, dass fünf Jahre ausschließlicher Beschäftigung mit Lachenmanns Musik zur Abkoppelung von anderen musikalischen Erfahrungen führt. Für den Hörer und den Rezipienten war eine bestimmte Tendenz, die der Oper inhärent ist, auf die Spitze getrieben, nämlich die arbeitsteilige Erzeugung eines Gesamtkunstwerkes. Das stellt besondere Belastungen an die Mitwirkenden, stellt eine besondere Zumutung dar. Nun kann man die Frage aufwerfen: Werden solche Stücke in Zukunft nur noch von Spezial-Ensembles ausgeführt, die sich mit besonderen Spiel- und Kultur-Techniken vertraut machen? Oder wird es im Repertoire-Betrieb des deutschen Staats- und Stadttheaters auch noch mitgenommen als Bestandteil eines breiten Spektrums, das von Monteverdi bis zur Gegenwart reicht? Spezial-Ensembles werden ihre Aufgaben ggf. sehr perfekt ausführen können. Wenn aber Oper mit breiter Basis in einer konkreten kommunalen, regionalen Öffentlichkeit funktioniert und Bedeutung behält, dann kann dies ein respektabler Beitrag zu einem demokratischen kulturellen Spektrum sein. Das Einmalige am mitteleuropäischen Theaterbetrieb ist ja, dass bislang eine erhebliche Breite gegeben war und dass allen Opernkrisen zum Trotz ein allgemeiner Anspruch des Musiktheaters aufrechterhalten wurde. Man kann ihn preisgeben aus ökonomischen Gründen oder aus künstlerischen Erwägungen, nach denen man erstrebenswerte Perfektion nur noch Spezial-Ensembles zutraut. Ich neige aber gerade aus kulturpolitischen Erwägungen dazu, den „breiten Anspruch“ des Stadt- und Staatstheaters nicht vorschnell preiszugeben.
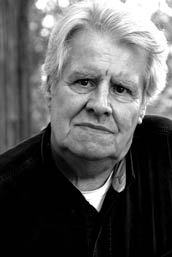 |
||
|
VdO-Geschäftsführer Stefan Meuschel. Foto: Johannes Radsack |
||
Meuschel: Um Ihre Frage von vorhin zu beantworten: Es ist schlagender Beweis, dass sich in den beiden Häusern Staatsoper Stuttgart und Hamburgische Staatsoper auch die Produktion „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ völlig reibungslos in den Betrieb einfügen ließ. Das sogenannte Tarifrecht im Musiktheater-Bereich ist wirklich so flexibel, dass die Verantwortung für die Verlängerungen der Probenzeit eben nicht vom Tarifvertrag diktiert, sondern in den Betrieb verlagert wird. Wenn das dann im Betrieb schiefgeht, wenn das Einvernehmen zwischen Theaterleitung und Chor nicht hergestellt werden kann, dann muss man fragen, warum das so ist.
Volksdorf: Ein Thema Ihres Kongresses war auch die Frage nach „Chor und Regie“. Das scheint ein heißes Eisen zu sein. Wir sind vorhin auch über die Frage ins Gespräch gekommen, inwiefern ein Chorvorstand zum Beispiel ein Mitspracherecht bei der Spielplanpolitik haben sollte. Herr Reininghaus, ich dachte ja, in Zeiten des modernen Regietheaters wäre nicht nur jeder Solist, sondern auch fast jeder Chorist glücklich. Dem ist nicht so.
Reininghaus: Der Konflikt zwischen Regisseuren und Mitarbeitern hat mancherlei Ursachen und Ausprägungen. Ein Grund für Unzufriedenheit der übrigen Mitarbeiter kann sich einstellen, wenn ein Regisseur zum Beispiel seine Sichtweisen eines Stückes beziehungsweise seine „Zutaten“ nicht aus der Sache selbst ableitet, sondern wenn er offensichtlich von werkfremden oder gar theaterfremden Überlegungen geleitet wird. Solange Stücke aus dem Geist des Regietheaters interpretiert, die Aktualisierungsbedürftigkeit und Brüchigkeit der Stücke selber beim Wort genommen werden, solange die Vorgehensweisen auch in den Häusern den Mitarbeitern vermittelt wird, müsste und dürfte es funktionieren.
Meuschel: Der Chor maßt sich nicht an, Beurteiler des Regietheaters zu sein oder eine wesentliche Partie in dieser heillosen Diskussion um das Regietheater spielen zu wollen. Was der Chor aber zu Recht verlangen kann: Ob Regietheater oder Nicht-Regietheater, wenn da irgendein Schauspiel-Hansel kommt, der nicht einmal Noten lesen kann, und behauptet, er inszeniere jetzt Oper; wenn irgendein hergelaufener Filmregisseur kommt und dem Opernchorsänger einen Helm überstülpt und sagt „Jetzt sing mal schön“ oder „Steh dabei die ganze Zeit mit dem Rücken zum Publikum“ – gegen all diese Dinge, die rein auf handwerklichem Unvermögen beruhen, sollte sich der Chor viel stärker zur Wehr setzen, als er es tut. Denn die schaden allen. Die schaden dem Musiktheater, die schaden dem Chor und befördern eine Regiekultur, die wir nicht haben wollen, nämlich die Regiekultur der Amateure.
Volksdorf: Herr Brauer, ist die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Regisseuren für Sie als Chordirektor ein ständiger Kompromiss im Hinblick auf die Klangkultur?
Brauer: Oft, ja. Im Chorsaal versucht man ein Optimum an Qualität zu bringen, und dann kommt der Regisseur... Es gibt sehr viele Regisseure, mit denen man wunderbar zusammenarbeiten kann. Es gibt aber eben auch die Regisseure, die wirklich von der Musik keine Ahnung haben, die sich ein Bild gemacht haben von einem Stück ohne Musik, und die das dann versuchen umzusetzen. Die Menge der Regisseure allerdings, gerade auch in der letzten Zeit, die bei uns in Dresden gearbeitet haben, die haben schon wirklich ein sehr gültiges und sehr gutes Konzept gehabt und sind vor allem für Hinweise vom Chorvorstand oder von mir zur klanglichen oder musikalischen Realisation dankbar.
Volksdorf: Herr Reininghaus, kürzlich erst veröffentlichte die Zeitschrift „Opernwelt“ wie jedes Jahr ihre Umfrage, eine Spielzeitbilanz für die Spielzeit 2003/2004. Da gibt es nun in diesem Jahr kein Opernhaus des Jahres, sondern es wurde das deutsche Stadttheater in seiner Gesamtheit zum Opernhaus des Jahres gekürt. Hat denn dieses weltweit einzigartige deutsche Stadttheatersystem eine Zukunft? Ist es so, wie es ist, wo jetzt Glanz und Elend so nah beieinanderliegen, für kommende Generationen überhaupt zu erhalten?
Reininghaus: Das deutsche Staats- und Stadttheatersystem hat Zukunft – bei allen ihm zugefügten Beschädigungen durch die immer wieder zum Zuge kommenden Banden und Einzeltäter minderen Talents! Die Frage ist nur, wie die Perspektiven aussehen: ob sie „weitere Verschlankung“ bedeuten oder ob die Politiker – von der Bundesebene bis hinunter zu denen der finanziell zweifellos gebeutelten Städte – bereit sind, dieses Kleinod zu erhalten und in der geopolitisch betrachtet kleinen Region Mitteleuropa diese Besonderheit zuzulassen. Wenn sie das Theatersystem jetzt demontieren, wird dieselbe Politikerkaste sich in 30 oder 50 Jahren die Haare raufen und fragen, warum „man“ eine einst zukunftsfähige Kulturlandschaft mutwillig beschädigte.
Volksdorf: Herr Meuschel, Sparen contra Erhalt der historisch gewachsenen Theater- und Kulturlandschaft: Was konkret kann denn die VdO tun, um Kündigungen zu verhindern, um die Theater in ihrer Struktur, in ihrer Substanz zu erhalten?
Meuschel: Sie leistet etwas, das an sich gegen ihre Überzeugung ist, sie schließt, gemeinsam mit anderen Gewerkschaften, Haustarifverträge ab. Sie tut das an den Theatern, an denen die Alternative heißt: Personalabbau, Spartenschließung oder sonst eine einschneidende Maßnahme. Und sie tut es nach Befragung ihrer Mitglieder: Was ist dir lieber, dein Gehalt oder dein Arbeitsplatz? Und wie viel von deinem Gehalt bist du bereit, aufs Spiel zu setzen, um deinen Arbeitsplatz zu erhalten? Es gibt inzwischen 64 Haustarifverträge in der Bundesrepublik, die im Orchesterbereich mit eingerechnet. Die VdO ist sozusagen eine Art Mischung aus Notarzt und Feuerwehr.
Volksdorf: Wobei viele Häuser diese Haustariferträge als eine Notlösung, eine Lösung für eine bestimmte Zeit, also eine Überbrückungsphase oder -möglichkeit verstehen.
Meuschel: Alle drei Künstlergewerkschaften, die Deutsche Orchestervereinigung, die Bühnengenossenschaft und wir, waren sich einig: Dieses Instrument darf nur dann angewendet werden, wenn ein absehbarer Zeitraum wirtschaftlicher Schwierigkeiten zu überbrücken ist. Inzwischen haben wir natürlich lernen müssen, dass dieser absehbare Zeitraum ein unabsehbarer geworden ist. Wie das dann im Endeffekt enden soll und ob es überhaupt wieder die Möglichkeit gibt, dass diese durch Haustarifverträge schlechter zahlenden Theater sich wieder in den normalen Geleitzug eines Flächentarifvertrages einreihen können, ist eine offene Frage. Was die VdO aber auch machen kann: Wenn sich schon alles ändert, müssen wir mithelfen beim Ändern und müssen auch bereit sein zum Ändern. Da wird sicherlich vieles auf die Chöre zukommen, nicht nur auf die Chöre, sondern auch auf die Ensembles. Ich bin der Meinung, dass der Opernchor sich – zum Beispiel durch eigene Konzerte – stärker ins Kommunalleben einbringen könnte, als er es tut. Da bestehen gewisse Chancen. Ich sagte vorhin kritisch, ein Kunstkommunikationsinstitut wie das Theater leide unter dem Mangel an innerer Kommunikation. Ein Großteil der Stadttheater leidet auch an einem Mangel an Kommunikation nach außen. Wenn ich in eine Kartenverkaufshalle eines Theaters morgens hineinkomme, und es ist kalt und staubig und eine unfreundliche Verkäuferin weiß kaum, was abends gespielt wird, dann frage ich mich: Warum liegen hier nicht Zeitungen, und warum kann ich hier nicht meinen Espresso trinken, während ich das Programmheft lese? Das Stadttheater sollte doch mehr sein als nur die abendliche Darbietungsstelle für mehr oder weniger gute Inszenierungen. In Aachen hatte Esterhazy das Problem: Soll der Chor Adventssingen machen? Unsere Kollegen waren völlig verdutzt, als sie bei uns um Rat fragten und wir sagten: Wenn das unter vernünftigen Bedingungen stattfindet, dann raus mit dem Chor und rein in die Stadt. Die Stadt muss wissen, dass es euch gibt.
Volksdorf: Raus mit dem Chor und rein in die Stadt – ich glaube, damit hat Frau Schäfer mit ihrem 24 Mann starken Chor kein Problem. Ich denke aber, es ist Zeit für ein Resümee, und das würde ich gerne zuerst von Ihnen erfragen, Frau Schäfer: Nicht alle haben drei Tage an diesem Kongress teilnehmen können, dennoch, denke ich, gibt es bestimmte Ergebnisse, Hoffnungen und Wünsche, Anregungen, die Sie von diesem Kongress, von dieser ersten Bundesversammlung mitgenommen haben und die Sie jetzt natürlich zu Hause an die Kollegen weitergeben werden Frau Schäfer?
 |
||
|
Claudia Schäfer. Foto: VdO |
||
Claudia Schäfer: Ja natürlich! Wir sind hierhergekommen
in der Hoffnung, dass wir unsere Position als VdO-Ortsdelegierte
stärken können, dass wir das lernen. Und soweit ich aus
Gesprächen mit vielen heraushören konnte, haben wir das
auch gelernt.
Meuschel: Und wir haben thematisiert, wo wir veränderungsbereitwillig
sind und wo wir vielleicht sogar gegen manche Überzeugung
an den Veränderungen mitarbeiten müssen.
Volksdorf: Müssen Opernchorsänger per se mehr Eigeninitiative entwickeln? Ist das vielleicht auch ein Ergebnis dieses Kongresses, Frau Schäfer?
Schäfer: Ich denke, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wir versuchen das eigentlich schon an den Häusern. Wir versuchen ja, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir haben letztes Jahr in Coburg ein Galakonzert gegeben, weil wir wissen, wie wichtig es ist, dass die Öffentlichkeit uns als eine Säule des Theaters sieht.
Meuschel: So wenig die Gewerkschaft einen pädagogischen Auftrag gegenüber ihren Mitgliedern hat, war es aber doch auch ein wenig das Bestreben: Ihr müsst euch an selbstständigeres Handeln und Denken im Theater gewöhnen und es lernen, um eben im Theater auch als Partner ernst genommen zu werden! Dass ihr Euch im Dialog mit eurem Chordirektor bei den nicht stattfindenden Regiesitzungen zu Wort melden könnt, dass ihr wirklich mal gehört werdet: Wie beurteilen wir als die Macher eigentlich eine Premiere? Anstatt uns nur auf die Anmerkungen der Kritiker zu verlassen. Diese Selbstständigkeit des Ensemblekünstlers im Theater zu fördern, war eines der Ziele dieser Bundesversammlung.
|
|
|
© by Oper &
Tanz 2000 ff. |

