|
|
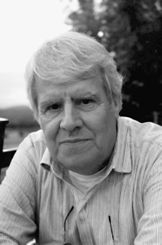 |
||
| Stefan Meuschel |
||
Wenn die Spielplan- und Inszenierungsprogrammatik einer neuen Intendanz auch nach längerer Zeit vom Publikum nicht angenommen wird, sind die Beschäftigten eines Opernhauses dann dazu verdammt, taten- und wortlos dem wirtschaftlichen Niedergang ihres Theaters zuzusehen? Ist der Intendantenvertrag mit der in ihm verankerten Kunstfreiheit des Theaterleiters auch dann noch zeitgemäß, wenn diese Kunstfreiheit mit haustrifvertraglichem Gagenverzicht erkauft werden muss, da der Rechtsträger nicht in der Lage ist, Haushaltsdefizite auszugleichen?
Warum ist Kunst- und Theaterförderung zwar Pflichtaufgabe der Länder, aber nur freiwillige Aufgabe der Kommunen? Hat Kunstförderung einen anderen Stellenwert als Wirtschaftssubventionen?
Werden die Musikhochschulen ihrem Ausbildungsauftrag gerecht, wenn zwar jährlich Hunderte von Vokalisten ihre Abschlüsse machen, doch mangels guter deutscher Sänger hervorragend ausgebildete Koreaner für die Opernchöre engagiert werden? Da alles globalisiert und wirtschaftseffizient zu sehen ist: Wäre es nicht ratsam, die Musikhochschulen mit entsprechendem Sprachunterrichtsauftrag gleich nach Südkorea zu verlegen?
Wie sehen die Lehrpläne der Musikhochschulen in Theorie und Praxis eigentlich aus? Für die Opernchorsänger? Für die Orchestermusiker? Welche Berufsbilder werden vermittelt? Warum etablieren die großen Orchester eigene Orchesterakademien?
Warum rekrutieren sich die deutschen Tanzensembles aus hochbegabten Ausländern? Ist es nur eine Frage der regionalen Mentalität oder steckt auch Bequemlichkeit dahinter?
Weshalb liegt im Musiktheater das Ensemble darnieder? Weshalb nutzen die Theaterleitungen nicht den Fundus an Erfahrungen, über den die meist längerfristig engagierten Kollektive verfügen?
Wie ist die Stellung des Opernchores im Theater, wie wird er von außen wahrgenommen?
Warum fühlen sich Opernchorsänger samt ihrem Chordirektor oft, als seien sie das fünfte Rad am Wagen?
Wollte nicht schon Mozart, dass seine italienischen Opern ins Deutsche übersetzt werden? Muss jedes Werk in der Originalsprache gesungen werden – und sei sie noch so abgelegen? Ist es nicht unwahrhaftig, etwas zu singen oder zu dirigieren, was sprachlich allenfalls oberflächlich verstanden ist? Sind die Leuchtschriftanlagen nicht eine wahre Pest?
Warum müssen Bühnenbildner ihre für die Ewigkeit
konstruierten Dekorationen nicht
wenigstens einmal selber auf- und abbauen?
Wie wird sich die Theaterästhetik entwickeln? Integriert und benutzt sie die Medien oder sucht sie neue Distanz? Wie behauptet sich das Theater in einer theatralisierten Umwelt?
Welche Stellung nimmt das Musiktheater in der Gesellschaft ein? Ist es noch unverzichtbarer Bestandteil der Bildungspolitik?
Wo liegen die Schwächen, wo die Stärken der VdO? Ist die Verbindung von Berufs- und Gewerkschaftsverband ein zukunftsträchtiges Modell?
All diese und noch viele andere, noch viele lästerliche und unbequeme Fragen haben die Bundesdelegierten der VdO auf bisher zwei Workshops zusammengetragen, die der Vorbereitung der VdO-Bundesversammlung 2004 dienten. Die Bundesversammlung wird unter Beteiligung aller VdO-Delegierten der deutschen Opernhäuser sowie mit Unterstützung des ConBrio Verlages und der Agentur Harten & Breuninger vom 10. bis 12. Oktober 2004 in Halle an der Saale stattfinden.
![]() Ihr
Stefan Meuschel
Ihr
Stefan Meuschel
|
|
|
© by Oper &
Tanz 2000 ff. |

