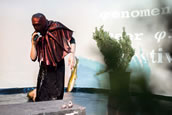|
|
Schwerpunkt: Freies Musiktheater Freie Szene, feste HäuserKulturpolitische Horizonte des Freien MusiktheatersVon Irene Lehmann Freies Musiktheater, das ist ein vielfältiges und vielgestaltiges Genre zwischen Musik, Oper und Theater, immer mit Experimenten an neuen ästhetischen Rändern befasst, mit Neugier für die Musiktheaterformen der Renaissance, des Barock, der asiatischen und europäischen Opernformen, der neuen, experimentellen und zeitgenössischen Musik… Freies Musiktheater ist mit dabei, wenn es darum geht, neue vernachlässigte Positionen im musiktheatralen Opernkanon wiederzuentdecken oder Klangkunst mit postdramatischem Theater, Tanz oder digitalen Medien zu verbinden. Die Experimente im ästhetischen Bereich erstrecken sich auch auf die künstlerische Zusammenarbeit: zum einen auf der Suche nach der Überwindung von Dominanzschemata des 19. Jahrhunderts (erst das Theater? erst die Musik?); zum anderen in wechselnden Zusammenarbeiten zwischen Solo-Künstler:innen, Gruppen und Kollektiven, kokreativen Zusammenarbeiten über verschiedene, auch technische Expertisen hinweg, oder Kooperationen auf internationaler Ebene. SchwierigkeitenDiese große Innovationsfreude könnte Antworten für die Transformationsaufgaben der Gegenwart bereithalten. Doch häufig trifft sie auf Förderstrukturen, die interdisziplinären Kunstformen wenig gerecht werden, kompliziert sind und langfristige Planungen schwierig machen. Das Freie Musiktheater ist trotz seiner vielen Vorläufer und historischen Quellen eine relativ junge Kunstform, die noch im Aufbau eigener Strukturen begriffen ist. Großangelegte Förderungen wie sie der zeitgenössische Tanz seit den 2010er Jahren und die zeitgenössische Musik seit den 1990er Jahren erlebten, führten in nachhaltiger Weise zu einer großen Sichtbarkeit, internationalen Strahlkraft und kulturellen Attraktivität der jeweiligen Zentren. „ϕeerroom” von the paranormal ϕeergroup mit Timo Knorr beim Hamburger Festival Stimme X 2022 Doch der enorme Spardruck, der seit 2024 in Bundesländern und Kommunen auch erfolgreiche und gut etablierte freie Strukturen erfasst hat, betrifft auch die festen Häuser. Die Förderquoten in fast allen Förderlinien stehen weit hinter dem künstlerischen Potenzial zurück. Bei der Einzelprojektförderung im Bereich Darstellende Kunst/Tanz in Berlin verschärft sich beispielsweise das Missverhältnis von förderwürdigen und geförderten Projekten von Jahr zu Jahr. Von den 16 Projekten, die 2026 in der Einzelprojektförderung von 79 für förderwürdig befundenen tatsächlich gefördert werden, zählt ein einziges Projekt zum Bereich Musiktheater. Der relativ verzweifelte Kommentar der Jury betont die Notwendigkeit einer Strukturförderung für dieses Genre, soll es sich überhaupt entfalten können. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Studie des Netzwerk Freies Musiktheater von 2024, die sowohl Einblick in die Arbeitsweisen und -realitäten der Akteur:innen gibt, als auch Problematiken der Förderstrukturen aufzeigt. Bemerkt sei, dass der Umriss einer in Konstitution befindlichen Szene sich eher qualitativ als quantitativ erfassen lässt. (Netzwerk Freies Musiktheater, „Das freie Musiktheater in Deutschland. Ein Szene-Kompass“) Neben dem Mangel an langfristigen und zielgenaueren Förderungen fehlt es auch an Gastspielstrukturen, die es im Bereich des Tanzes und der Performancekunst mit dem Nationalen Performance Netzwerk und den internationalen Produktionshäusern bereits gibt. Für das Sprechtheater ist die Öffnung der Gastspielhäuser (INTHEGA) vielversprechend. Kooperationen?Die erwähnte generelle schwierige Lage einerseits, aber auch der Wunsch der festen Häuser, größere Teile der Gesellschaft ästhetisch zu repräsentieren und anzusprechen, lässt Akteur:innen über mögliche Kooperationen nachdenken. Verschiedene Formate brachten bereits spannende Ergebnisse und öffnen neue Horizonte. Die sich wandelnde Kulturlandschaft macht es lohnenswert, einen genauen Blick auf Chancen, Herausforderungen und Best Practice-Beispiele zu werfen. Im Folgenden trage ich Ansätze zusammen, die unter anderem im Netzwerk Freies Musiktheater (NFM) diskutiert werden, in Tagungen des Bundesverbands Freier Darstellender Künste (BFDK) und des Verbands Freier Ensembles und Orchester (FREO) sowie in Netzwerken, die sich mit Nachhaltigkeit befassen wie etwa Performing For Future. Aufschlussreich ist zudem das Projekt FairStage, das vom LAFT Berlin, Diversity Arts Culture, dem ensemble-netzwerk und dem Berliner Senat getragen wird. (LAFT Berlin, „Repräsentation, Leerstellen Ausschlüsse. Über diversitätssensibles Arbeiten an Theatern“, Berlin 2024). Benjamin van Bebber beim Kölner Festival ORBIT 2024. Foto: Sophia Hegewald Trotz genrespezifischer Unterschiedlichkeiten sind die Bedingungen für Kooperationen für Musik, Musiktheater und Sprechtheater sehr ähnlich. Die schon bestehenden Kooperationen zeigen überdies, dass Hürden überwindbar sind und förderpolitisch über Erleichterungen nachgedacht werden sollte. Nicht unterschlagen werden soll aber, dass Kooperationen auch aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsweisen und Ästhetiken herausfordernd sind, weshalb die Befragten der Studie des Netzwerk Freies Musiktheater Opernhäuser als bevorzugte Aufführungsorte nur auf Rang 4 platzieren, nach Sprechtheatern auf dem 3. Platz, Festivals und Freien Szene-Orten. Dies unterstreicht die Eigenständigkeit der Kunstform, die nur in spezifischen Ausprägungen als zeitgenössische Variante der Oper zu verstehen ist. Die Studie verdeutlicht auch, dass das Arbeiten in der Freien Szene von den meisten Akteur:innen bewusst gewählt wird und keinesfalls als Durchgangsstation oder Notlösung betrachtet wird. Akteur:innen wählen die Freie Szene wegen der größeren künstlerischen Freiheit in kleinen Strukturen und um manchen toxischen Arbeitskonstellationen an den Festen Häusern zu entkommen. Die zahlreichen gelingenden Kooperationen, die es dagegen auch zwischen Akteur:innen der Freien Szene und der Opernhäuser gibt, zeigen aber auch das Potenzial dieser Zusammenarbeiten. Grundsätzlich gibt es vier Bereiche, in denen engere oder losere Kooperationen stattfinden:
Ressourcen teilenDie Möglichkeiten, wie infrastrukturell geförderte feste Häuser die kleinen freien Ensembles partizipieren lassen können, sind vielfältig: Freie Ensembles haben aufgrund der Projektförderungen wenig eigene Probenräume, während Spielstätten in kleineren Städten nicht immer belegt sind. Das Theater Düsseldorf setzt ein Konzept der Dritten Orte um und öffnet sein Foyer tagsüber als Arbeits- und Leseraum für die Stadtgesellschaft, wodurch sofort eine andere Durchlässigkeit entsteht. Nachhaltigkeit ist ein besonderes Thema: In größeren Städten und zum Teil regional gibt es eine Vielzahl von Initiativen, die Materialkreisläufe zwischen Freier Szene und Festen Häusern organisieren. Gute Kooperationen gibt es dabei viele, denn verstaubende Kostüm-Fundi und ein Müll-Container Bühnenbild pro Inszenierung sind immer wieder ein trauriger Anblick. Gute Sharing-Systeme stärken zudem die Kommunikation der Beteiligten. Ein großes Wissenspotenzial liegt im gemeinsamen Überdenken von Produktionstechniken, mit dem Ziel, dass Grundmaterialien im Bühnenbau besser weiter verwendet werden können und Nachhaltigkeit schon früh im Produktionsprozess mitgedacht wird. Die Verwaltung von Sharing-Strukturen ist allerdings nicht zu unterschätzen, da auch Online-Datenbanken und Verleih nicht mit punktuellen Förderungen auskommen. Das Potenzial dieser Orte und Initiativen ist aber umso größer, da Verleihsysteme sogar mit öffentlichen Bibliotheken, kommunaler Stadtreinigung, Repair-Cafés oder anderen sozialen Strukturen verknüpft werden können. (Link) Künstlerische ZusammenarbeitenAuch die Möglichkeiten der künstlerischen Zusammenarbeit reichen von engeren zu loseren Modellen. Zuweilen werden freie Regieteams, Musikensembles oder Solist:innen für besondere Produktionen als Gäste an ein Haus eingeladen. Sie bringen andere Perspektiven und andere Fähigkeiten mit als im fest engagierten Ensemble vorhanden. Im Bereich des Gesangs etwa verlangen die Ausbildungen schon früh eine Festlegung auf Stimm- und Rollenfach, die jedoch nur einen kleinen Teil der Möglichkeiten der menschlichen Stimme abbildet. Spezialist:innen für neue und experimentelle Musik, für nicht-europäischen Gesang und Instrumentalspiel oder historische Instrumente sind deshalb als Gäste gerne gesehen. Manche Theater (zum Beispiel in Erfurt) bieten Residenzen für Stückentwicklungen durch Gruppen der Freien Szene an, während in der Förderung NOperas! des NRW KULTURsekretariats die Kooperation und Stückentwicklung einer freien Musiktheatergruppe an zwei bis drei Opernhäusern gefördert wird. Die Deutsche Oper Berlin lädt in ihre Nebenspielstätte freie Produktionen ein, in denen ganz neue Stoffe, selten gespielte Stücke der Moderne oder Neuperspektivierungen des Kanons gezeigt werden. Die Oper Leipzig plant indessen für 2026 zusammen mit dem Musiktheaterfestival Tracks eine Neuproduktion, die im selben Zeitraum durch kleinere Produktionen in verschiedenen freien Spielstätten der Stadt gezeigt werden. So entsteht ein vielschichtiges Mosaik von Sichtweisen. Der Bedarf nach frischem Wind in den Opernhäusern ist deutlich spürbar, da der sehr eingeschränkte feste klassische Kanon von lediglich 80 Werken zunehmend an Legitimität verliert. Das große Potenzial von Kooperationen liegt also sowohl in einer Begegnung mit neuen Kompetenzen, neuem Wissen und der Bereicherung des Programms in den verschiedensten Epochen, als auch in der Möglichkeit, frei produziertes Musiktheater präsent zu machen und jeweils neues Publikum zu erreichen. Publikum während der Aufführung von LICHT24 in der Werkbühne Leipzig beim Festival TRACKS 2024. Foto: Yannic Borchert Die großen Hürden solcher Zusammenarbeiten liegen zum einen in den förderbedingten kurzfristigen Planungshorizonten der freien Gruppen, während die festen Häuser mit zwei- bis dreijährigem Vorlauf planen. Es wäre förderlich, an dieser Stellschraube kulturpolitisch zu drehen. Doch es gibt auch Beispiele, in denen Häuser überjährig Mittel reservieren, die dann durch mehrmalige Zusammenarbeiten oder offene Ausschreibungen genutzt werden. Die experimentelle Ästhetik des zeitgenössischen und freien Musiktheaters greift häufig über den Raum der Bühne hinaus: sowohl der Theaterraum als auch der akustische Raum werden seit den frühen Avantgarden offener gedacht. Technische Besonderheiten sind zu berücksichtigen, um etwa elektronische Kunstmusik adäquat umzusetzen. Für solche Projekte braucht es zusätzliche Zeit, um Abläufe anzupassen und eventuell freie Tontechniker:innen einzubeziehen. Die Erfahrungen aus Förderprogrammen zur Kooperation von Freier Szene und Festen Häusern zeigen, dass es einen realistischen Blick für diese Zusammenarbeiten braucht: Manche Abläufe werden komplexer und benötigen mehr Ressourcen als das standardisiert produzierte Repertoire-Stück. Ein Austausch über Kenntnisse muss nicht als Konkurrenz betrachtet werden, wie ein bestimmter neoliberaler Blick auf die freien Künstler:innen als neues Ideal von Arbeit nahelegte. Eine Spezialistin im Belcanto muss diesen Bereich nicht gegen zeitgenössische experimentelle Stimmtechniken und Sprechgesang eintauschen. Wenn der Blick stattdessen auf den Eigenwert der verschiedenen Zugangsweisen geht, können diese als Bereicherung erlebt werden. Wissen teilenJe enger die künstlerischen Zusammenarbeiten anvisiert werden, umso mehr bedarf es klarer Absprachen und Zielsetzungen, da das Potenzial für Konflikte nicht zu unterschätzen ist. Dies liegt zum einen an den verschiedenen Produktionslogiken, in die die Akteur:innen eingebunden sind, zum anderen an unterschiedlichen Bedürfnissen und Arbeitsweisen. Die Akteur:innen und das Publikum der Freien Szene sind in ihrer Diversität nach wie vor zu wenig in den Leitungsebenen von Stadttheatern und Opernhäusern repräsentiert. Künstler:innen wählen die Arbeit in der Freien Szene auch, weil sie steile hierarchische Arbeitsorganisationsformen nicht als förderlich empfinden und vielmehr respektvolle Kooperationen und Kommunikation auf Augenhöhe suchen. Feste Häuser können von den Erfahrungen profitieren, die die freien Szenen in der Entwicklung von inklusiven, mehrsprachigen und kollektiven Arbeitsformen immer wieder sammeln. Solche Prozesse erfordern jedoch Zeit und gelingen auch nur, wenn Mitarbeiter:innen aus allen Gewerken eingebunden werden: Wenn diese in ihren Belangen gehört werden, sind sie offener für Impulse von außen. Ein produktives Beispiel ist das Projekt FairStage, bei dem der Berliner Senat in Reaktion auf den Machtmissbrauch an einigen städtischen Theatern Akteur:innen der Freien Szene beauftragte, Modelle für mehr Inklusion und Diversität zu entwickeln. Auch wenn Empfehlungen zur Reform der Intendanzfindung bisher noch wenig umgesetzt werden, ist doch klar: Transformationsprozesse an den festen Häusern einzuleiten, ist unumgänglich, soll Theater, Oper und Konzert weiterhin einer diversen Gesellschaft gerecht werden und nicht von einem Machtskandal in den nächsten stolpern, was Legitimität kostet und das Vertrauen in öffentliche Institutionen untergräbt. Für die wechselseitige Begegnung auf Augenhöhe ist es wichtig, sich Modelle von Partizipation auch theoretisch vor Augen zu führen, da eine halbherzige Partizipation in bloße Symbolhandlung umschlägt, egal ob es sich um Bürgerbühnen oder um Akteur:innen der Freien Szene handelt. (Sherry Arnstein, „A ladder of citizen participation“, in: Journal of the American Institute of Planners, 35 (4) 1969, S. 216–224) Um das Spektrum der Partizipation auszuweiten, wenn es darum geht, Vertreter:innen der Stadtgesellschaft einzubeziehen, findet sich in der Freien Szene ein großer Wissensfundus. Dies weiter zu explorieren war das Kollektiv Staub und Glitzer für ein Modellprojekt an der Volksbühne Berlin angetreten, das in der Kooperation von Freier Szene und Festen Häusern ganz neue Horizonte öffnen würde. (https://podcast.dissenspodcast.de/296-kunst) Solidarisch in kulturpolitischen VerhandlungenEine letzte Möglichkeit der Kooperation sind solidarische Positionierungen in kulturpolitischen Verhandlungen und das Ausloten gemeinsamer Interessen. Diese lassen sich bündeln und Kulturminister:innen überraschen, wenn kulturelle Akteur:innen von festen und freien Strukturen gemeinsam auftreten, wie kürzlich in Sachsen-Anhalt geschehen. Die gegenwärtigen Kürzungen machen deutlich, dass alle davon betroffen sind, dass das Verständnis für Kultur als Ausdruck und Ort der Zivilgesellschaft am Schwinden ist, sei es, weil Marktlogiken dagegen gesetzt werden, sei es, weil rechte Akteur:innen die Kulturstätten als Begegnungsorte einer offenen Gesellschaft angreifen und zerstören wollen. In der gegenwärtigen Verfasstheit von Freier Szene und Festen Häusern ist der beste Weg ein respektvolles Miteinander, das die Eigenheiten von kleinen und großen Entitäten ernst nimmt, gleich einem Ökosystem, das Stabilität und Resilienz aus der Vielfalt seiner Lebensformen bezieht. Irene Lehmann ist promovierte Theaterwissenschaftlerin, Dramaturgin, Kuratorin und Redakteurin mit Schwerpunkt Musiktheater. Sie kuratierte und koordinierte 2023/24 das Fortbildungsprogramm des Landesverbands Freie Darstellende Künste Berlin und co-leitet die AG Digitale und Analoge Diskurse im Netzwerk Freies Musiktheater. Eckdaten zum Freien Musiktheater
|
|
|
|
© by Oper &
Tanz 2000 ff. |